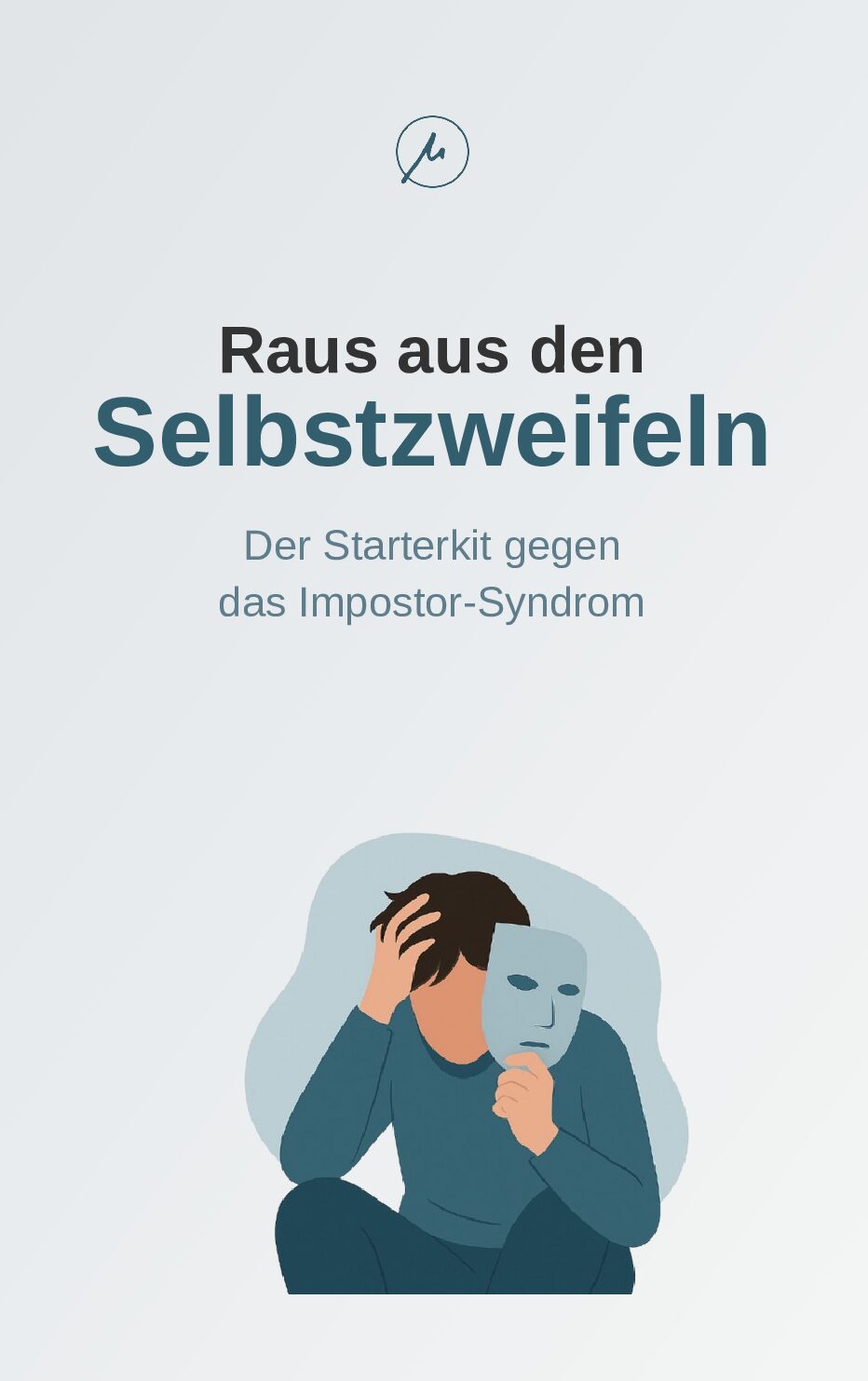Was ist das Impostor-Syndrom?
Definition, Fakten und 4 verbreitete Irrtümer
Impostor-Syndrom: Was steckt wirklich dahinter?
Haben Sie auch schon vom Impostor-Syndrom gehört? Kein Wunder, denn in den letzten Jahren wurde immer häufiger darüber berichtet. Leider wird aber nicht immer korrekt beschrieben, worum es sich dabei handelt.
Schon aus dem Namen lassen sich falsche Rückschlüsse ziehen. Und auch in der öffentlichen Wahrnehmung kursieren einige Annahmen über das Impostor-Syndrom, die mir in meinen Beratungen sehr häufig begegnen, die aber schlicht und ergreifend falsch (und manchmal auch gefährlich) sind.
Doch schauen wir uns zunächst an, was das Impostor-Syndrom überhaupt ist.
Impostor-Syndrom – über 45 Jahre alt und moderner als je zuvor
Der Begriff wurde erstmals in den 1970er Jahren von der US-amerikanischen Psychologin Pauline Clance verwendet. Sie hatte bei Studierenden beobachtet, dass diese trotz guter Leistungen und Noten das Gefühl hatten, sie hätten ihre Erfolge nicht verdient und würden früher oder später als Betrüger*innen entlarvt. Besonders bemerkenswert war dabei, dass vor allem leistungsstarke und erfolgreiche Studierende diese Gedanken äußerten. Clance beschrieb die betroffenen Personen mit folgenden Worten:
Nur selten erfahren sie die Freude, die Befriedigung und das Gefühl der Erfüllung, das sich normalerweise mit dem Erfolg einstellen müsste. […] “Was ich auch tue – es ist nicht genug. Ein wirklicher Erfolg wird mir nie zuteil”, denken sie. Sie schämen sich ihrer Zweifel und halten ihre Empfindungen gewöhnlich geheim.
Pauline Clance
Typische Merkmale des Impostor-Syndroms sind:
-
die Überzeugung, nicht gut genug zu sein
-
die Angst, als nicht kompetent enttarnt zu werden
-
das Abwerten eigener Erfolge
-
das Überbewerten von Fehlern
-
die Angst, anderen nicht gerecht zu werden
-
das Gefühl, Erfolge seien nur auf Glück, Zufall oder Beziehungen zurückzuführen
-
zunehmende Selbstzweifel bei steigendem Erfolg
In den letzten Jahren wurde das Phänomen mit immer stärkerer Intensität erforscht – mehr als die Hälfte der Veröffentlichungen darüber erschien in den letzten 10 Jahren. Dies zeigt, wie relevant dieses Phänomen für uns und unser Leben geworden ist.
Doch obwohl fast jede/r schon einmal von diesem Phänomen gehört oder gelesen hat, gibt es vieles, was dazu falsch wiedergegeben und entsprechend auch falsch weitergegeben wird. Und dieses Halbwissen kann gefährlich sein, denn es führt dazu, dass die Betroffenen sich falsch einordnen, dass sie sich keine Hilfe holen und dass sie viel zu lange und unnötig unter den Auswirkungen des Impostor-Syndroms leiden.
Die 4 häufigsten Irrtümer über das Impostor-Syndrom
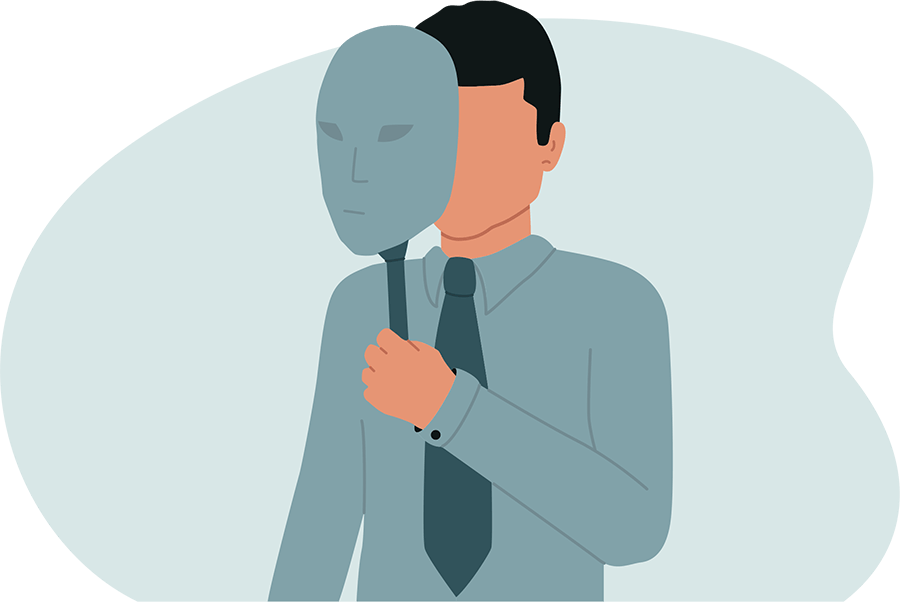
Irrtum 1: Das Impostor-Syndrom ist eine Krankheit
Viele Menschen glauben, es handle sich um eine psychische Erkrankung. Doch das ist falsch. In internationalen Klassifikationen wie der ICD-11 oder dem DSM-5 taucht das Impostor-Syndrom nicht als eigenständige Diagnose auf.
Betroffene sind also nicht krank. Vielmehr handelt es sich um ein Phänomen, das bei bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen und in bestimmten Situationen auftreten kann. Fachlich korrekt wäre es sogar, vom „Impostor-Phänomen“ zu sprechen. Der Begriff „Syndrom“ hat sich jedoch umgangssprachlich und zum Teil sogar auch in der Fachliteratur eingebürgert.
Irrtum Nr. 2: Beim Impostor-Syndrom geht es um Hochstapler
Das Impostor-Syndrom wird im Deutschen auch als Hochstapler-Syndrom bezeichnet. Leider ist der Begriff irreführend, denn ein Hochstapler oder eine Hochstaplerin gibt bewusst falsche Angaben zu den eigenen Qualifikationen und Fähigkeiten an und erschleicht sich so unrechtmäßig bestimmte Positionen.
Beim Impostor-Syndrom ist genau das Gegenteil der Fall: Die Betroffenen haben die Qualifikationen und Fähigkeiten, sind leistungsstark und erfolgreich, zweifeln aber dennoch an sich. Sie schreiben ihre Erfolge äußeren Umständen zu und glauben, die eigene Kompetenz reiche nicht aus.
Wenn Sie sich also fragen:
-
Habe ich meine Position zu Recht?
-
Habe ich meine Abschlüsse und Zertifikate ehrlich erworben?
-
Habe ich meine Stelle mit falschen Angaben bekommen?
… und Sie die ersten beiden Fragen mit Ja und die letzte mit Nein beantworten können, dann sind Sie kein/e Hochstapler/in. Sie fühlen sich nur manchmal so.
Irrtum Nr. 3: Jeder, der Selbstzweifel hat, leidet unter dem Impostor-Syndrom
Selbstzweifel sind ein zentrales Merkmal beim Impostor-Syndrom – aber nicht jeder, der an sich zweifelt, ist automatisch betroffen. Es gibt durchaus gesunde Selbstzweifel, die jeder Mensch kennt. Sie treten zum Beispiel auf, wenn man eine neue Aufgabe übernimmt, sich in unbekannte Themen einarbeitet oder eine ungewohnte Herausforderung meistert.
Diese normalen Selbstzweifel gehören zum Leben dazu, verschwinden mit der Zeit wieder und müssen nicht behandelt werden.
Wenn Sie gelegentlich an sich zweifeln, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass Sie unter dem Impostor-Syndrom leiden. Behandlungsbedürftig sind vor allem die Selbstzweifel, die hartnäckig bleiben oder mit wachsendem Erfolg sogar zunehmen. Das ist typisch für das Impostor-Syndrom.
Irrtum 4: Wer unter dem Impostor-Syndrom leidet, ist ein Ausnahmefall
Viele Betroffene glauben, sie seien die Einzigen mit solchen Gedanken und Gefühlen. Doch das Gegenteil ist der Fall.
Studien zeigen, dass zwischen 40 und 70% der Menschen mindestens einmal im Leben solche Gedanken haben. Besonders häufig tritt das Impostor-Syndrom in bestimmten Berufsgruppen auf, etwa bei Mediziner/innen, Akademiker/innen oder Führungskräften. In einer Untersuchung unter Medizinstudierenden gaben sogar 90 % der Befragten an, vom Impostor-Syndrom betroffen zu sein.
Warum ist das so wenig sichtbar? Weil die meisten ihre Zweifel und Ängste nicht offen aussprechen. Nach außen wirken sie souverän und kompetent und gerade dadurch bleibt unsichtbar, wie viele hinter den Kulissen mit sich hadern.
Wer ist besonders häufig vom Impostor-Syndrom betroffen?
Das Impostor-Syndrom tritt häufig bei Menschen mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen und in bestimmten Lebensphasen auf. Betroffen sind vor allem:
-
Perfektionist*innen
-
Menschen mit geringem Selbstwertgefühl
-
Introvertierte
-
Personen in Vorreiter-Rollen (z. B. als Erste*r in der Familie mit akademischem Abschluss)
-
Angehörige von Minderheiten
-
Personen, die stark im Fokus der Öffentlichkeit stehen
Anders als früher angenommen, scheint das Geschlecht dabei eine geringere Rolle zu spielen.
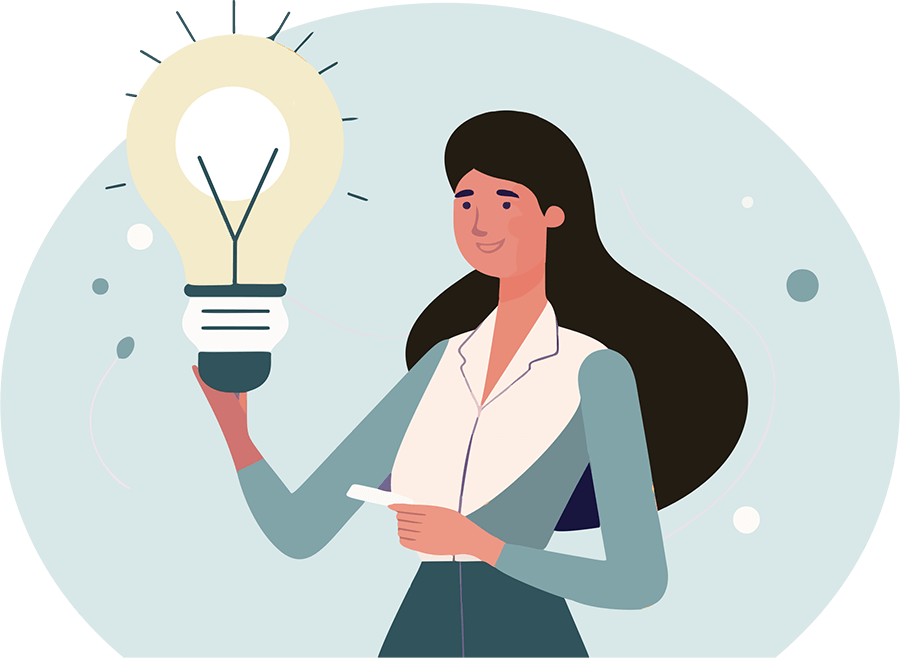
Fazit
Sie sehen: Rund um das Impostor-Syndrom gibt es viele Missverständnisse und Halbwahrheiten. Diese zu erkennen ist wichtig, damit Betroffene ernst genommen werden – und damit keine falschen Schlüsse gezogen werden, die eher verunsichern als helfen.
Wenn Sie sich in einigen Punkten wiedererkannt haben, dann wissen Sie jetzt: Sie sind nicht allein. Und vor allem: Sie können etwas verändern.
Sie müssen da nicht alleine durch. Ich unterstütze Sie gern auf Ihrem Weg heraus aus dem Impostor-Syndrom.
Weitere Artikel, die Sie interessieren könnten:
Sie sind besser, als Ihr Impostor Ihnen weismachen will!
Höchste Zeit, das zu erkennen. Mein kompaktes Workbook zeigt Ihnen die ersten wichtigen Schritte zu mehr Selbstvertrauen.